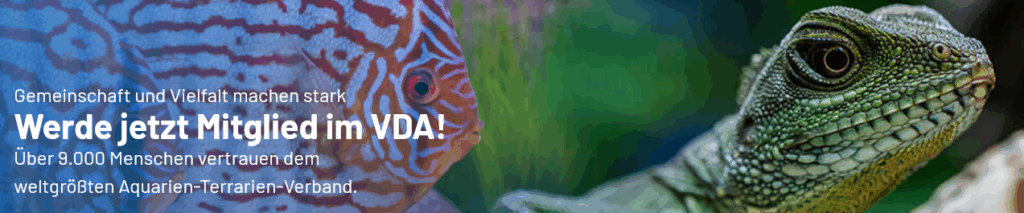Der Axolotl (Ambystoma mexicanum) ist mir persönlich eine sehr bedeutsame Molchart, aber in diesem Jahr wird diesem spannenden Schwanzlurch auch international und jenseits des Aquaristikhobbys viel Aufmerksamkeit zuteil. Im Juni 2025 ging sein Name (der aus der aztekischen Sprache Nahuatl stammt und soviel wie „Wassermonster“ oder auch „Wassergott“ bedeutet) gleich zweimal groß über die Presseticker.
+++ Dieser Text von mir ist in der Zeitschrift VDA-aktuell Heft 3/2025 erschienen +++

Am 17.06.2025 vermeldete die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) „Axolotl liefert Stoffe gegen Krankenhauskeime und Krebs. MHH-Forschende finden antimikrobielle Peptide auf Axolotl-Haut, die nicht nur gefährliche Krankenhauskeime, sondern auch Tumorzellen bekämpfen.“ Hinter dieser Überschrift steht die Arbeit der Forschungsgruppe um Dr. Sarah Strauß, Leiterin des Kerstin Reimers Labors für Regenerationsbiologie an der MHH. Diese Forschungsgruppe untersucht sogenannte antimikrobielle Peptide (AMP) aus dem Hautschleim der Axolotl. Ich habe vor einigen Jahren die Gelegenheit gehabt, diese Forschungsgruppe zu besuchen, und war damals bereits beeindruckt von dem, was dort geleistet wird.
Bereits am 25.07.2025 kam dann die nächste Pressemeldung zum Axolotl über die Ticker. An diesem Tag wurde verkündet, dass die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ihren höchstdotierten Wissenschaftspreis in diesem Jahr einer Wissenschaftlerin verleiht, die mit Axolotln forscht. Den mit 1,9 Millionen Euro dotierten Wittgenstein-Preis erhielt die US-amerikanische Biochemikerin Elly Tanaka, die die Regeneration komplexer Körperstrukturen untersucht. Hierbei dient Ihr der Axolotl als Modellorganismus.
Dies bringt mich zum Gegenstand dieser Buchbesprechung, nämlich dem Buch mit der Geschichte hinter den Geschichten. Der Axolotl ist nämlich nicht irgendein beliebiger Modellorganismus. Er ist vielmehr einer der in der Wissenschaftsgeschichte bemerkenswertesten tierischen Modellorganismen überhaupt. Genau wie Krallenfrösche (Gattung Xenopus) sind Axolotl aber immer mehr gewesen als bloße Studienobjekte in Wissenschaft und Forschung. Sie waren und sind zugleich auch beliebte Pfleglinge in der Vivaristik. Und beide haben neben ihrer Bedeutung in der Aquaristik (bzw. Aqua-Terraristik) leider auch die (undankbare) Rolle als „Haustier“ in vielen Wohnzimmern erlangt. Die Sozialen Medien sind voll mit Bildern und Videos aus aller Welt, die nicht artgerecht gepflegte Axolotl zeigen. Gründe für diese „Popularisierung“ weit über die Grenzen des vivaristischen Hobbys hinaus sind neben den verschiedenen Farbmorphen, die den Axolotl in manchen Augen besonders interessant erscheinen lassen, fraglos auch der popkulturelle Rang dieser Tiere. Angefangen bei der „Axolotl Schuhfabrik“ im 1931 erschienenen Schauspiel „Der Hauptmann von Köpenick“ von Carl Zuckmayer, über Helene Hegemanns Romane „Axolotl Roadkill“ (2010) und „Axolotl Overkill“ (2017) bis zu Axolotln in verschiedenen modernen Spielewelten (von Minecraft bis Pokémon) – diese Tiere sind Kult.

Wer nun aber wirklich verstehen will, wie der Axolotl zum wissenschaftlichen Modellorganismus wurde, und wie er Einzug in die Vivaristik fand, dem sei das Buch von Christian Reiß „Der Axolotl. Ein Labortier im Heimaquarium 1864-1914“ empfohlen. Es zeichnet mit großer Genauigkeit den Weg der allerersten Axolotl aus Mexiko nach Europa nach. Die Verwunderung der europäischen Forscherinnen und Forscher über die gelegentlich vorkommende, zumeist aber ausbleibende Metamorphose dieser Schwanzlurche ist spannend nachgezeichnet. Ihre frühen Versuche, die Metamorphose künstlich auszulösen, markieren den Anfang der Forschung mit diesem späteren Modellorganismus. Das Buch basiert auf einer Doktorarbeit, preisgekrönt von der Gesellschaft für Geschichte der Wissenschaften, der Medizin und der Technik e. V. (GWMT), und ist durch Kürzungen und Überarbeitungen sehr angenehm zu lesen. Besonders innovativ an seinem Ansatz ist die Fokussierung auf die Axolotl, also die Tiere selbst, als Mittelpunkt seiner geschichtlichen Erzählung. Die Tiere als Subjekt und nicht mehr wie früher als Objekt von Forschung zu betrachten, ist spannend aus allgemeinem Erkentnisinteresse heraus, aber besonders natürlich aus Perspektive unserer vivaristisch erfahrenen Leserschaft. Wir kennen Axolotl auf die eine oder andere Weise zumeist sehr gut, viele Vivarianer haben sie bereits selbst gepflegt. Zugleich sind wir dadurch natürlich ein besonders anspurchsvolles Publikum, denn Dinge, die wir vermissen (beispielsweise die Beschreibung von Haltungssystemen und Haltungspraktiken über einen allgemeinsam Kenntnistand hinaus – Stichwort Wasserwechsel, Wasserwerte, Fütterung, Beleuchtung, usw.) fallen dem uninformierten Leser gar nicht auf. Ich sehe hierin für Forschung wie jene von Christian Reiß ein großes Potential. Gleichsam als eine Facette von Bürgerwissenschaft (Citizen Science) könnten unsere geschulten Augen das Blickfeld der historisch forschenden Wissenschaft weiten.

Das Kenntnisse und Erkenntnisse aus der privaten Haltung (oft als „Liebhaberei“ bezeichnet) bereits bei der frühen Forschung am Axolotl eine wichtige Rolle spielten, stellt Reiß sehr deutlich heraus. Dabei handele es sich um einen „bisher unberücksichtigten Aspekt in der Frühgeschichte experimenteller Forschung in den Lebenswissenschaften“ (S. 120). Wir können, aufbauend auf Publikationen wie der von Christian Reiß, zukünftig darauf hoffen, dass die Rolle der Privathalter in der Geschichte der Biologie und verwandter Wissenschaften stärker Beachtung wund Würdigung finden wird.
Ich kann jedem, der sich für das Charisma des Axolotls begeistern kann, dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Zu erfahren, wie mit 34 Axolotln, die 1864 Paris erreichten, die globale Erfolgsgeschichte des Axolotl begann, ist definitiv eine Lektüre wert!
Christian Reiß: Der Axolotl. Ein Labortier im Heimaquarium 1864-1914, Göttingen: Wallstein 2020, 299 S., 5 Kt., 16 s/w-Abb., ISBN 978-3-8353-3306-2, EUR 29,90 [Werbung, Link zu Amazon]
VDA-Mitglied werden, um die VDA-aktuell im Abo zu bekommen…